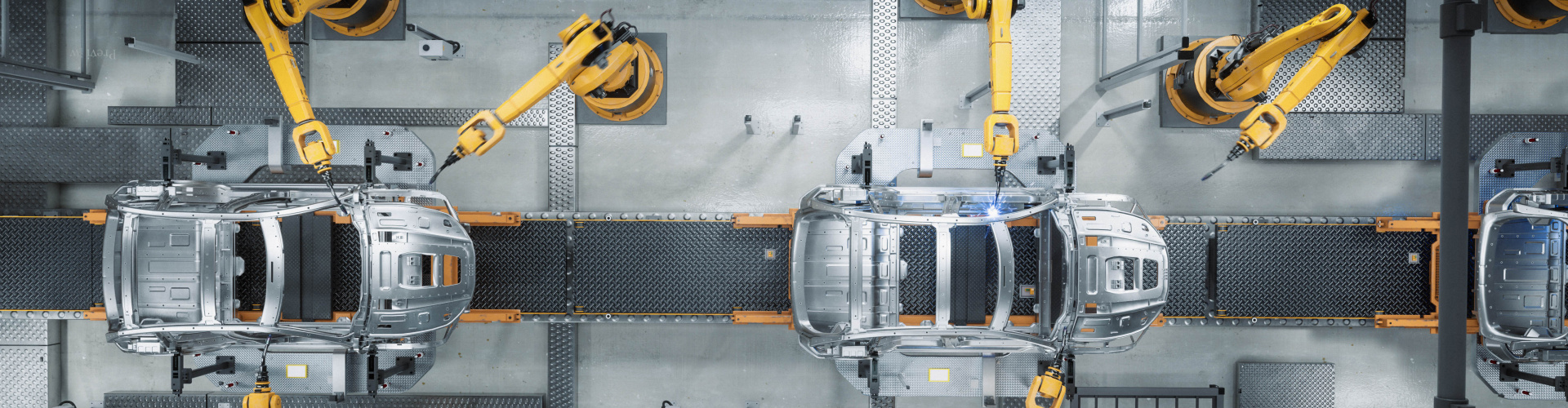„Metallhydride haben viele Vorteile, auch fürs Outback”
Dr. Paul Jerabek erforscht am Helmholtz-Zentrum Hereon Metallhydride zur Speicherung von Wasserstoff. Als Teil einer europäischen Delegation hat er diese Technologien Partnern aus Politik, Wirtschaft und Industrie in Australien vorgestellt. Die Reise wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) unterstützt und durch den europäischen Think-Tank Adelphi organisiert. Zur Delegation gehörten der Parlamentarische BMWE-Staatssekretär Stefan Rouenhoff, die Stahl-Holding-Saar, die Hamburg Port Authority (HPA), H2Global und Thyssenkrupp Nucera Australia sowie die RWTH Aachen, das Fraunhofer ISE und die BTU Cottbus-Senftenberg. Paul Jerabek verrät, welche Chancen die Reise für die Wasserstoffforschung am Hereon bringt.
Welche Stationen lagen auf der Reise durch Westaustralien?

Dr. Paul Jerabek auf der Delegationsreise vor einem Muldenkipper. Copyright: Paul Jerabek
Wir haben die University of Western Australia besucht und uns Projekte zur Wasserstoffproduktion und -speicherung in Perth angeschaut. Außerdem waren wir in einer Eisenerz-Mine in der Pilbara-Region und in der Hafenstadt Geraldton, wo gerade ein Projekt zur Erzeugung von grünem Eisen geplant wird. Zum Schluss haben wir am Australia-EU Hydrogen Supply Chain Forum in Perth teilgenommen. Das ist eine Tagung zur Entwicklung einer grünen Wasserstoffwirtschaft, bei der über 200 Regierungs-, Industrie- und Wissenschaftsvertreter aus Europa und Australien zusammenkamen. Das Ziel unserer Delegationsreise war der fachliche Austausch zur klimaneutralen Eisenproduktion und innovativen Wasserstofftechnologien, an denen wir auch am Hereon forschen. Australien hat wegen seiner herausragenden Wind- und Solarressourcen großes Potenzial erneuerbare Energien zu erzeugen und zu nutzen – auch in Form von grünem Wasserstoff.
Welche neuen Erkenntnisse brachte die Reise?
Für mich als Materialforscher war es sehr lehrreich zu sehen, mit welchen Fragen sich die Industriepartner und die Politik beschäftigen müssen, um eine grüne Wasserstoffwirtschaft umsetzen zu können. Da geht es um Fragen wie: Wie wird der erzeugte Wasserstoff vom Elektrolyseur in den Speicher gebracht? Welche Technologien, Infrastruktur und Sicherheitskonzepte sind dafür erforderlich? Wie wird der gespeicherte Wasserstoff weiter transportiert? Diese Schnittstellen zwischen der Erzeugung, Speicherung und dem Transport sind für unsere Hereon-Forschung besonders relevant, denn wir entwickeln genau dafür innovative Lösungen. Außerdem haben wir auf der Reise Einblicke in verschiedene Industrieprojekte bekommen, bei denen neben Australien auch noch andere Länder involviert sind. Das zeigt, dass wir die Treibhausgasreduktion weltweit durch internationale Zusammenarbeit und den Austausch von Know-How beschleunigen können.
Sie forschen am Hereon an sogenannten Metallhydriden zur Wasserstoffspeicherung. Werden diese Technologien bald in Australien eingesetzt?
Ich habe unsere Hereon-Technologien australischen Partnern vorgestellt und bin auf großes Interesse gestoßen. Metallhydride haben gegenüber herkömmlichen Hochdrucktanks viele Vorteile, die auch für den Einsatz in abgelegenen Regionen wie dem Outback wichtig sind. Sie können Wasserstoff bei deutlich niedrigerem Druck und niedrigerer Temperatur speichern. Das reduziert die Sicherheitsanforderungen erheblich und vereinfacht die Handhabung. Außerdem bieten Metallhydride wie Eisentitan die Möglichkeit einer komplett reversiblen Speicherung. Sie geben den vorher gespeicherten Wasserstoff also jedes Mal vollständig wieder ab und verlieren auch bei wiederholter Wasserstoffaufnahme und -abgabe kaum an Speicherkapazität. Das unterscheidet sie beispielsweise von Batterien, die über die Nutzungszeit immer weniger Energie speichern und irgendwann ersetzt werden müssen. Metallhydridmaterialien eignen sich hervorragend für langfristige Energiespeicherung.
Welche Herausforderungen gibt es auf dem Weg zu einer grünen Wasserstoffwirtschaft?
Eine zentrale Herausforderung ist die wettbewerbsfähige Erzeugung, Speicherung und der Transport von Wasserstoff über große Distanzen. Die Integration neuer Technologien in vorhandene Wertschöpfungsketten ist sehr komplex, verursacht hohe Kosten und ist gerade für Unternehmen mit Risiken verbunden. Mit unserer Hereon-Forschung zu Metallhydriden tragen wir dazu bei, die Kosten zu reduzieren und die Sicherheit zu erhöhen, was für die Wirtschaftlichkeit entscheidend ist. Außerdem können wir maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Anwendungsfelder entwickeln, die auch den extremen Anforderungen in der Industrie standhalten. Einer unserer aktuellen Forschungsschwerpunkte ist etwa die Nutzung alternativer Rohstoffquellen zur Herstellung von Metallhydridmaterialien, beispielsweise aus natürlich vorkommenden Mineralien oder sogar aus Metallschrott. Damit möchten wir die Wasserstoffspeicherung nachhaltiger und wirtschaftlicher machen.
Haben sich durch die Reise neue Forschungskooperationen für das Hereon ergeben?
Ich konnte erste Kontakte mit der Firma Iluka Resources knüpfen. Die baut in Australien mineralhaltigen Sand ab und verfügt über große Vorräte an Mineralien wie Ilmenit. Am Hereon erforschen wir in einem laufenden Projekt mit neuseeländischen Partnern, wie aus diesem Mineral kostengünstig Materialien zur Speicherung von Wasserstoff gewonnen werden können. Iluka wird uns künftig Proben ihrer Mineralien zuschicken, die wir in unseren Laboren untersuchen können. Die Chancen stehen gut, dass sich darüber hinaus bald neue Forschungsprojekte mit australischen Partnern ergeben. Australien ist zurzeit in Gesprächen mit der EU, um als gleichberechtigter Partner in dem EU-Förderprogramm „Horizon Europe“ mitwirken zu können. Neuseeland hat so ein Abkommen bereits 2024 mit der EU geschlossen, was zu zahlreichen gemeinsamen Projekten geführt hat. Wenn Australien nachzieht, könnten auch wir als Hereon uns zusammen mit australischen Partnern auf EU-geförderte Forschungsprojekte bewerben. Das wäre eine großartige Chance für unsere Forschungsarbeit.
Hereon-Forschung in Neuseeland
Dass Forschungskooperationen mit Partnern am anderen Ende der Welt gelingen können, zeigen zwei laufende Projekte, die das Helmholtz-Zentrum Hereon in Neuseeland umsetzt. Seit 2021 baut Hereon in Zusammenarbeit mit der University of Otago ein deutsch-neuseeländisches Forschungszentrum für grünen Wasserstoff in Dunedin auf. Dort wird die Herstellung, Speicherung und Nutzung des Wasserstoffs erforscht.
Ein zweites Projekt widmet sich seit 2022 der Herstellung von Wasserstoffspeichermaterialien aus neuseeländischen Ressourcen. Die Forschenden untersuchen unter anderem, ob der in Neuseeland in großer Menge verfügbare Ilmenit-Sand (titanreicher Eisensand) genutzt werden kann, um Metalllegierungen auf Basis von Eisentitan zur Wasserstoffspeicherung zu erzeugen.
Vita
Dr. Paul Jerabek hat an der Philipps-Universität Marburg im Fachbereich Theoretische Chemie promoviert. Anschließend lebte er mehrere Jahre lang in Neuseeland, wo er als Humboldt-Stipendiat an der Massey University forschte. Nach seiner Rückkehr und Station am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung kam er 2019 ans Hereon-Institut für Wasserstofftechnologie. Hier koordiniert er unter anderem die zwei Wasserstoff-Forschungsprojekte mit Neuseeland. Seit 2022 ist er stellvertretender Abteilungsleiter für Materialdesign. Im April 2025 übernahm er zudem eine Dozentur an der Technischen Universität Hamburg (TUHH) im Bereich Wasserstofftechnik. Jerabeks Forschungsschwerpunkte liegen an der Schnittstelle von theoretischer Chemie, Materialdesign und innovativen Wasserstofftechnologien.
Spitzenforschung für eine Welt im Wandel
Das Ziel der Wissenschaft am Helmholtz-Zentrum Hereon ist der Erhalt einer lebenswerten Welt. Dafür erzeugen rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Wissen und erforschen neue Technologien für mehr Resilienz und Nachhaltigkeit – zum Wohle von Klima, Küste und Mensch. Der Weg von der Idee zur Innovation führt über ein kontinuierliches Wechselspiel zwischen Experimentalstudien, Modellierungen und künstlicher Intelligenz bis hin zu Digitalen Zwillingen, die die vielfältigen Parameter von Klima und Küste oder der Biologie des Menschen im Rechner abbilden. Damit wird interdisziplinär der Bogen vom grundlegenden wissenschaftlichen Verständnis komplexer Systeme hin zu Szenarien und praxisnahen Anwendungen geschlagen. Als aktives Mitglied in nationalen und internationalen Forschungsnetzwerken und im Verbund der Helmholtz-Gemeinschaft unterstützt das Hereon mit dem Transfer der gewonnenen Expertise Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bei der Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft.
Kontakt und weiterführende Links
Wissenschaftler
Institut für Wasserstofftechnologie
Tel.: +49 (4152) 87-2604